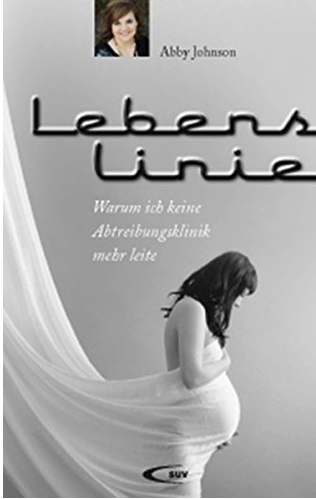Abby Johnson
Lebenslinie , Warum ich keine Abtreibungsklinik mehr leite – St Ulrich Verlag Augsburg 2012
Vielleicht wirkt das Buch „Lebenslinie – Warum ich keine Abtreibungsklinik mehr leite“ von Abby Johnson deswegen so authentisch, weil die Autorin dem Leser detaillierten Einblick in ihre inneren Kämpfe gewährt, die dazu geführt haben, dass sie sich aus der Haltung, Frauen helfen zu wollen unter Inkaufnahme von Abtreibungen, befreien konnte.
Mit 26 Jahren Leiterin der Klinik
Die Geschichte der heute 40jährigen Abby Johnson ist schnell erzählt: Das idealistisch gesinnte College-Mädchen wird auf der Suche nach einer ehrenamtlichen Tätigkeit von „Planned-Parenthood-Freiwilligen“ davon überzeugt, dass diese Organisation, der Dachverband von „Pro Familia“, sich in USA am meisten für die Rechte der Frauen einsetzt und durch ihre Aufklärungsarbeit die Zahl der Abtreibungen senkt.
Sie durchläuft aufgrund ihres Einsatzes schnell die Stufenleiter der Organisation und wird schon mit 26 Jahren Leiterin einer Abtreibungsklinik in Texas.
Als diplomierte Psychologin berät sie vor allem Frauen, die in die Klinik kommen, um eine Abtreibung vornehmen zu lassen. Sie selbst hat zwei Abtreibungen hinter sich, stellt sich aber der persönlichen Auseinandersetzung mit dem, was dabei geschieht, nicht.
Das ändert sich schlagartig, als sie erstmals bei einer Abtreibung assistiert und im Ultraschall mitverfolgen kann, wie sich das Baby im Mutterleib gegen die Absaugpipette zu wehren sucht. Diese Bilder öffnen ihr die Augen für die Wirklichkeit des Geschehens, an dem sie bisher mitgewirkt hat, was sie nach dieser Erkenntnis keinen weiteren Tag tun kann. Sie gibt ihre Stelle auf und arbeitet von jetzt an mit den Lebensschützern zusammen.
Auf zwei Seiten des Zauns
Jenseits von Schwarz-Weiß-Malerei oder eines einfachen Freund-Feind-Bildes berichtet die Autorin von ihren Begegnungen und Freundschaften mit Menschen auf beiden Seiten des Zauns. Sowohl in der Klinik und der Organisation „Planned Parenthood“ trifft sie idealistisch gesinnte Menschen, die Frauen in schwierigen Situationen helfen wollen und davon überzeugt sind, einer guten Sache zu dienen, als auch in der Begegnung mit Freiwilligen von „Pro Life“, die mit ihren Gebeten, ihrem freundlichen Verhalten und ihren Hilfsangeboten Frauen im letzten Moment von einer Abtreibung abhalten wollen.
Ihr kommen zwar immer wieder Zweifel, ob sie auf der richtigen Seite des Zauns steht.
Das Eingebundensein in die Strukturen der Organisation, ihr Zusammengehörigkeitsbewusstsein, ihre Argumente, und letztlich auch ihre persönliche Überzeugung, Frauen helfen zu können, z.B. wenn sie sich für eine Adoption entscheiden, zerstreuen aufkommende Zweifel. Dabei spielt ihre Verdrängung der eigenen Abtreibungen eine nicht eingestandene wichtige Rolle.
Mit der Realität beginnt sie sich erst auseinanderzusetzen, als seitens der Leitung der Organisation Druck ausgeübt wird, die finanziellen Schwierigkeiten des Unternehmens durch eine Erhöhung der Abtreibungszahlen zu lösen.
Sich der Wirklichkeit stellen
Der dadurch entstehende Konflikt – sie war ja in der Überzeugung angetreten, Frauen helfen zu wollen, auch Ja zu ihrem Kind zu sagen – bricht dann mit voller Wucht aus, als sie erstmals hautnah damit konfrontiert wird, dass es sich bei jeder Abtreibung um die Tötung eines Babys handelt.
Die Autorin selbst stellt sich die Frage, wie es möglich sein konnte, in aller Naivität diese Wirklichkeit bis dahin ausgeblendet zu haben. Sie macht aber glaubwürdig klar, dass es bei ihr und einigen anderen Mitarbeitern in der Klinik tatsächlich so war, dass sie „einen Bogen“ um dieses Geschehen gemacht haben.
Ein guter Ausgang
Entscheidend dafür, dass sie sich an jenem Septembertag 2009 der Wirklichkeit stellt, waren letztlich die Begegnungen mit Menschen, deren Haltung sie überzeugte: ihre Eltern, die nicht mit ihrer Tätigkeit einverstanden waren, sie aber nie fallen gelassen haben, ihr Mann, der auch gegen die eigene Überzeugung immer zu ihr gehalten hat, die Geduld, der Glaube und die Liebe, mit der ihr die Leiter der „Pro Life“-Organisation begegnet sind. Diese sind es auch, die ihr dabei helfen vor Gericht gegen die Anklage von „Planned Parenthood“ zu siegen und eine neue Arbeit zu finden.
Der Leser nimmt Anteil an der inneren Zerrissenheit eines Menschen, der in guter Meinung handelt, aber in der Tiefe seines Gewissens spürt, dass er nicht richtig handelt; er wird hineingenommen in die religiösen Auseinandersetzungen der verschiedenen Kirchen, in denen es „pro choice“- und „pro life“-Anhänger gibt: er kann besser die Haltung der einen und der anderen verstehen, ohne sie gleich pauschal zu verurteilen: er wird aber auch zu einer ehrlichen persönlichen Stellungnahme geführt, was seine eigene Position in dieser überlebenswichtigen Frage betrifft.
Wieder beten können
Nachdenklich dürfte den Leser die Feststellung der von Hause aus gläubigen Christin machen, dass Gott für sie während ihrer Tätigkeit in der Klinik kaum noch eine Rolle spielte, obwohl ihre Sehnsucht nach ihm immer wieder aufflackerte. Erst in dem Maße, wie sie sich der Wirklichkeit und den daraus resultierenden Konsequenzen stellt, kann sie wieder beten und eine vertiefte Beziehung zu Gott aufbauen. Ostern 2011 ist sie, wie der Klappentext ausweist, katholisch geworden.
Dem von Alexandra M. Linder in gut lesbares deutsch übertragenen Buch kann man nur in Deutschland einen ähnlichen Erfolg wünschen wie in den USA.