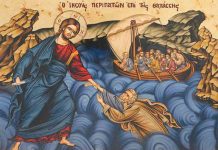Erkenntnis (scientia / γνῶσις)
Wo ist da der Unterschied?
Weisheit, Einsicht, Erkenntnis… Jetzt haben wir schon den dritten Begriff, der in die selbe Kategorie zu gehören scheint. Der eine oder andere mag sich fragen, ob das nicht alles irgendwie ähnlich ist. Spötter – denen so oft die öffentliche Meinung zu gehören scheint – mögen sogar behaupten, das sei „doch sowieso alles dasselbe“.
Präzises Denken, präzise Sprache
Aber so leicht sollte man es sich nicht machen und einfach gedankenlos jahrhundertealte philosophische und theologische Erfahrungen vom Tisch wischen. Die Nuancen sind wichtig, und es lohnt sich genauer hinzuschauen. Das ist auch der Grund für die hier angeführten philologischen Details, den Rückgriff auf die frühe Sprachgestalt der Dinge. Wie wichtig das ist, zeigt sich besonders deutlich bei dem Begriff der „Erkenntnis“, um den es hier geht. Die lateinischen und altgriechischen Worte dahinter haben es wirklich in sich!
Follow the science…?
Das lateinische Wort „scientia“ ist uns in der Übersetzung als „Wissenschaft“ geläufig; und tatsächlich wurde im deutschen Sprachraum die hier in Rede stehende Gabe des Heiligen Geistes auch mit diesem Wort bezeichnet. Selten fehlte dabei der Hinweis, dass es sich nicht um „Wissenschaft“ im landläufigen Sinne handele, also nicht um das Erwerben von Erkenntnissen und Einsichten auf dem Wege der experimentellen Forschung, im Sinne von Naturwissenschaft und Technik der Gegenwart. Diese Unterscheidung ist natürlich richtig und wichtig. Allerdings muss man sagen, dass die Gabe „scientia “ des Heiligen Geistes die naturwissenschaftliche Methode weder ausschließt noch ihr widerspricht.[1] Ganz im Gegenteil: dank dieser Gabe sind wir dagegen gefeit, Wissenschaft zu missbrauchen oder daraus ideologische Konzepte abzuleiten.
Worum es geht: Erkenntnis im vollen Wortsinn
„Scientia“ ermöglicht es dem menschlichen Verstand, über das Offensichtliche hinaus zu sehen, und auch noch tiefer zu schauen, als es quantifizierende und experimentelle Methoden erlauben:
- Es geht darum, das Wesen der Dinge zu erkennen, d.h. in ihnen die Schöpfungsordnung zu erahnen und den Willen des Schöpfers zu verstehen[2].
- Diese Erkenntnis führt auf den Weg zur „Weisheit“ und zur „Scheidung der Geister“, sie schützt uns vor kaltem Utilitarismus und vor dem Missbrauch von Wissen und Können, ohne aber diesen selbst Abbruch zu tun.
- Damit wächst in uns das Verständnis für den Sinn des Lebens. Die Gabe der Erkenntnis ist eine Voraussetzung für jede Ethik die diesen Namen verdient.
Wie war das mit der Gnosis?
Das Wort in unserem Bezugstext[3], das im Lateinischen als „scientia“ übersetzt wurde, lautet auf Altgriechisch „Gnosis“ (γνῶσις), und das hat bis heute noch einen ganz besonderen Klang, nicht weniger als scientia / science. Gnostische Lehren[4] und Sekten haben die Kirche seit der Spätantike immer wieder herausgefordert und bedrängt. Gnostiker bildeten typischerweise verschworene Gemeinschaften, in denen eine Art „Geheimwissen“ im Mittelpunkt stand, das im Rahmen von Initiationsriten innerhalb einer Elite von Eingeweihten weitergegeben wurde.
Die Fachliteratur über die Gnosis und ihre diversen Verästelungen füllt viele Bände. In unserem Zusammenhang ist es wichtig zu sehen, wie geradezu gegensätzlich ihre Auffassung von Erkenntnis zu der hier besprochenen war: Nicht als eine Gottesgabe wurde sie verstanden, die jedem Gläubigen offensteht, sondern als Geheimwissenschaft, die nur eingeweihten Mystagogen den Zugang zu höherer Einsicht ermöglicht.
Das kommt uns bekannt vor…
Darin sind gnostische Lehren der Spätantike vielen Sekten und Kulten ähnlich, die man auf der ganzen Welt bis zum heutigen Tag findet. Es ist auch kein Zufall, dass ähnliche Mechanismen und die dazugehörige Geheimniskrämerei auch in säkularistischen Ideologien verbreitet sind. Auch dort führt eine selbsternannte Elite die Massen zu einem vorgeblich hohen Ziel, das die Leute ohne Belehrung und Umerziehung angeblich nicht erreichen können; nur dass es sich dann um eine rein innerweltliche „Erlösung“ im Sinne einer Utopie handelt. Der Unterschied zu unserem Begriff von Erkenntnis als Gabe des Heiligen Geistes könnte nicht größer sein; er ist nicht nur graduell, sondern prinzipiell.
Sapere aude[5]
Wissenschaft und Technik und ihre Errungenschaften sind im Raum des abendländischen Christentums entstanden, was man getrost als Alleinstellungsmerkmal des christlichen Kulturraums bezeichnen darf. Insofern hat die eventuell etwas missverständliche Bezeichnung „Wissenschaft“ für die Gabe des Hl. Geistes doch auch ihr Gutes. Zumindest hat sie heuristischen Wert, hilft sie uns doch, diesen Zusammenhang von Christentum und Wissenschaft zu erkennen. Auch Universitäten im vollen Wortsinne (Einrichtungen, an denen die „Universitas Scientiarum“, also die Gesamtheit der Wissenschaften, gelehrt wurde) sind eindeutig eine „abendländische“ Erfindung.
Der menschliche Verstand wurde durch das Christentum aus Irrationalität und magischem Denken befreit, die Welt wurde seinem Forschen zugänglich. Waren früher Gestirne und Naturerscheinungen als Erscheinungsformen bzw. Tummelplatz zahlloser Gottheiten interpretiert worden, die man kultisch zu besänftigen trachtete, hatte dieser Spuk mit der Ausbreitung des Christentums ein Ende. Der Mensch musste sich nicht mehr als Spielball dräuender launischer Gottheiten sehen, die sein Leben bestimmten; er wurde freigesetzt zu selbständigem Tun.
In Verantwortung vor Gott und den Menschen
Wir wissen allerdings darum, was geschehen kann, wenn menschliche Erfindungs- und Schaffenskraft irregeleitet ist. Die Schrecknisse des 20. Jahrhundert geben Auskunft darüber. Um so wichtiger ist es, den Verstand und die Kreativität im richtigen Sinne zu verwenden, also in Verantwortung vor Gott und den Menschen (wie es die Präambel des deutschen Grundgesetzes bis heute formuliert). Genau dazu hilft uns die Gabe der Erkenntnis.
Gottesfurcht (pietas / εὐσέβεια)
Der Übergang zur Gabe der „Gottesfurcht“ könnte nicht passender sein, und die Zusammenstellung der Geistesgaben bei Jesaja erweist sich als keineswegs zufällig. Die Gabe der Erkenntnis eröffnet dem Menschen die ganze Welt; die Gottesfurcht ordnet sein Tun. Wir kennen das alle vom Gebrauch der Technik: Von der Dampfmaschine über das Flugzeug und die Kernkraft bis zur Künstlichen Intelligenz verlangt der menschliche Vernunftgebrauch nach der Ergänzung (manchmal sogar Zähmung) durch die Gottesfurcht.
Furcht und Schrecken?
Nun dürfen wir diesen Begriff nicht missverstehen: es geht natürlich nicht darum, Angst zu haben vor Gott, ihn womöglich zum Angstmachen zu instrumentalisieren. Ein Blick in die Religionsgeschichte macht verständlich, warum dieser Gedanke nicht so ganz fern liegt. Ob es nun der gnadenlose römische Kaiserkult war, oder die blutrünstigen Menschenopfer der Azteken, die verheerenden islamischen Eroberungen im frühen Mittelalter, oder die schrecklichen Religionskriege im Europa des siebzehnten Jahrhunderts; ebenso aber in unserer Zeit die ausufernde Aggressivität des radikalen Islam – immer wieder sind wir mit einem Phänomen konfrontiert, das Joseph Ratzinger / Benedikt XVI. so treffend als „Pathologien von Religion“ bezeichnet hat. Von dieser Art Verwirrung hatte uns die Predigt des Evangeliums ja gerade befreit.
Siehe: Dekalog
Fragt man sich, was denn nun wirklich mit „Gottesfurcht“ gemeint ist, findet man die erste Antwort in den zehn Geboten. Die ersten drei sprechen von der Ehrfurcht, die wir Gott schulden: Keine anderen Götter haben, den Namen Gottes nicht missbrauchen, den Feiertag heiligen. Nach allem bisher Gesagten versteht es sich fast von selbst, dass damit nicht eine schematische Gesetzesfrömmigkeit gemeint ist. Es kommt auf die innere Einstellung an; ohne diese wäre ein bloß äußerliches Befolgen von Regeln und Riten nicht heilsam[6].
Habt keine Angst!
Es gibt eine vulgär-aufklärerische Attitüde von Kirche und Glauben zu sprechen, bei der die Vorstellung propagiert wird, das Christentum sei voller Gebote und Drohungen, es verbreite Furcht. Dagegen sei das atheistische oder agnostische Weltbild ja so frei und beglückend. Man muss gar nicht erst wissenschaftliche Studien bemühen, die das Gegenteil beweisen, dass zum Beispiel gläubige Menschen deutlich weniger von Depression, Burnout und Lebenskrisen befallen werden. Wir alle sehen es in unserer „Lebenswirklichkeit“, was wirklich Angst macht, und was Trost gibt.
Joseph Ratzinger formulierte es schon vor Jahrzehnten sehr treffend: „In unserer Zeit, die dem Menschen die Heils- und Sündenangst genommen hat, wuchern diese neuen Ängste und nehmen vielfach schon die Form kollektiver Psychosen an…“[7] Angstmachend ist der christliche Glaube nicht, ganz im Gegenteil. Papst Johannes Paul II. sagte es treffend bei Antritt seines Pontifikats: „Habt keine Angst! Öffnet, ja reißt die Tore weit auf für Christus!“
Was bringt uns nun die „Gottesfurcht“? Nicht zufällig korrespondiert das mit der Erkenntnis:
- Ehrfurcht gegenüber Gott ist die Voraussetzung für ein Leben nach ethisch-moralischen Grundsätzen[8]. Gottesfurcht spricht auch aus der Präambel des Grundgesetzes: „In Verantwortung vor Gott und den Menschen“.
- Ohne ein Mindestmaß dieser Ehrfurcht gibt es auch keine tiefere Erkenntnis, Einsicht oder gar Weisheit[9]. Verantwortungsvoller Umgang mit der Schöpfung resultiert auch aus der Gottesfurcht.
- Ehrfurcht gegenüber Erscheinungen unserer Welt und gegenüber unseren Mitmenschen ist immer ein Abglanz der Gottesfurcht, denn Gott ist die Quelle und Ursache alles Guten[10].
Bild: Die Ausgießung des Heiligen Geistes an Pfingsten, Mainzer Evangeliar, um 1230/50
[1]Sie schließt sogar naturwissenschaftliches Forschen und Verstehen in einem höheren Sinne ein. Nur umgekehrt ist der uns geläufige Wissenschaftsbegriff nicht ausreichend, um den hier gemeinten philosophisch-theologischen Ausdruck zu erklären.
[2]Vgl. Carvajal, a.a.O. S. 336.
[3]LXX, Jes. 11, 2.
[4]Bei der Gnosis in diesem Sinne geht es nicht nur um ein gedankliches Erfassen im Sinne der Erkenntnistheorie, „sondern zugleich ein Schauen oder Einswerden mit dem Gegenstand der Erkenntnis“. RGG 3. Aufl. Bd. II., Sp. 1648.
[5]„Wage zu wissen / erkennen“ bzw. „dich deines eigenen Verstandes zu bedienen“, der Wahlspruch der Aufklärung (nach Immanuel Kant).
[6]Im doppelten Wortsinne: an Leib und Seele heilend und zum ewigen Heil hinführend.
[7]J. Ratzinger: Auf Christus schauen. Freiburg 1989. Zit. nach Carvajal, S. 380.
[8]Auch wenn diese oft etwas schwammig einfach als unsere „Werte“ bezeichnet werden.
[9]Die Mehrzahl der großen Naturwissenschaftler, die unser heutiges Weltbild mit aufgebaut haben, waren fromme Menschen. Vgl. hierzu den Beitrag https://erziehungstrends.info/darwin-der-kreationist
[10]Hier ist die deutsche Sprache erhellend, die schon im Wortklang die richtige Assoziation („Gut / Gott“) aufruft.