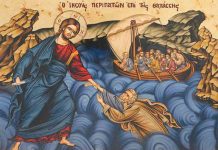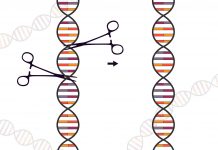Rat (consilium / βουλή)
Manchmal kann man sich des Eindrucks nicht erwehren, wir lebten in einer Zeit der maximalen Verwirrung und Desorientierung. Werte werden umgewertet und relativiert, Traditionen verworfen oder zumindest in Frage gestellt. Das ist natürlich keine neue Erfahrung der Menschheitsgeschichte, aber im Zeitalter der Digitalisierung ändern sich die Dinge schneller als je zuvor.
Karussell der Meinungen
In den „sozialen Medien“ herrscht bunte Vielfalt, oder wüstes Chaos (die Bewertung ist Ansichtssache). Fake News und „alternative Fakten“ sind anscheinend überall. „Influencer“ verbreiten millionenfach Moden und Einstellungen, und kreischende Social Media-Auftritte beeinflussen Konsum- und Wahlverhalten, nicht nur junger Menschen. Daneben mühen sich die traditionellen Medien mit erzieherischem Anspruch darum, bestimmte Haltungen und Meinungen zu verbreiten und andere zu verhindern. Das kann entmutigen, wenn man auf der Suche nach Wahrheit ist.
Da ist guter Rat teuer…
Eigentlich ist es gar nicht so schwer, sich ein Bild davon zu machen, was seriös ist und was nicht, wo wir informiert werden und wo manipuliert. Es bedarf allerdings einer gewissen Erfahrung und auch Anstrengung, um „die Geister zu scheiden“ und das Urteilsvermögen zu schärfen. Wie sollte uns da die Gabe des „Rates“[1] nicht willkommen sein? Und außerdem – anders als im Sprichwort – gibt es diesen Rat kostenlos!
Ein Alleinstellungsmerkmal
Wie passt so etwas wie eine Gabe des Heiligen Geistes namens „Rat“ in das Pandämonium des Meinungsmarktes im einundzwanzigsten Jahrhundert? Auf die richtige Fährte kann uns der altgriechische Begriff βουλή (Bulé) führen, der an der bekannten Stelle im Buch Jesaja (Jes 11, 2)[2] verwendet wird und u.a. einen „Ratschluss aufgrund göttlichen Willens“ bezeichnet[3]. Dieser ist nicht nur eine weitere Meinungsäußerung, wie viele andere, sondern er kann echte Orientierung bieten, im ursprünglichen Wortsinne. Wie schon bei der „Weisheit“ ist der spirituelle Grund entscheidend; wir vertrauen auf den göttlichen Ratgeber und seine Zusage (Psalm 32,8): „Ich unterweise dich und zeige dir den Weg, den du gehen sollst. Ich will dir raten; über dir wacht mein Auge“[4].
Und damit sind wir am entscheidenden Punkt angekommen. Es geht hier nicht einfach darum, dass man guten Rat annehmen und für Tipps und Hinweise offen sein soll; es geht nicht darum, sich von Experten oder Gremien beraten zu lassen – so gut und wichtig das alles im Einzelfall auch sein mag. „Rat“ im hier gemeinten Sinne, als Gabe des Heiligen Geistes, umfasst – mit den Worten des Hl. Thomas von Aquin – alles „was auf das Ziel des ewigen Lebens hingeordnet ist, sei es nun heilsnotwendig oder nicht“[5].
Das bedeutet konkret:
- Die Annahme dieser Gabe des Heiligen Geistes hilft uns dabei, unser Leben zu heiligen, auf das höhere Ziel hin ausgerichtet zu leben.
- In dieser Weise wird auch unser Rat an andere “geheiligt”, erfährt eine spirituelle Erhöhung, die uns frei macht von niederen Zielen, Egoismus und Hintergedanken.
- Die Tugenden der Wahrhaftigkeit und der Demut werden in uns gestärkt, und wir werden von krankhaftem Ehrgeiz, Missgunst und Unaufrichtigkeit geheilt.
Stärke (fortitudo / ἰσχύς)
Rat und Stärke – das ist schon im alltäglichen Sprachgebrauch eine gute Kombination. Aber was ist konkret mit der Stärke als Gabe des Heiligen Geistes gemeint?
Grundlage einer großen Tugend
Das lateinische Wort fortitudo bezeichnet auch die Tugend der Tapferkeit[6], und die Verbindung ist sprechend und keineswegs zufällig. Aber das Wort hat eine weite Konnotation, und die Verwendung des griechischen ἰσχύς[7] in unserem Bezugstext (Jes. 11. 2) legt nahe, dass es bei der Gabe der “Stärke” um einen etwas anderen Kontext geht: physische, vor allem aber mentale und moralische Festigkeit – gewissermaßen die Voraussetzung für Tapferkeit.
Stärke in der Schwachheit
Dass es bei der Gabe der Stärke nicht um einen Zaubertrank oder magischen Trick geht, der alle Probleme beseitigt, das ergibt sich aus dem gesamten Kontext des Neuen Testaments. Diese Gabe hilft aber dabei standzuhalten, sie baut uns selbst, unser Menschsein, auf; und das ist im Grunde viel besser. Besonders schön und deutlich formuliert es der Apostel Paulus, der trotz schwerer Lasten, Entbehrungen und Leiden schreiben kann: “Alles vermag ich durch ihn, der mir Kraft gibt”[8]. Nach all den Unbilden, Misshandlungen und Nöten durch die der Apostel wegen seiner Predigt, besonders auf seinen Missionsreisen, gehen musste, ist das eine starke Aussage.
Es war immer schon ein Alleinstellungsmerkmal des Christentums, dass es sich in der Schwachheit als stark erweist. Was zunächst paradox klingt, erscheint völlig logisch, wenn man daran denkt, wie Gott Mensch geworden ist, schwach und unscheinbar, in einem Stall; und wie die Erlösung der Menscheit geschah: nicht durch kosmische Manifestationen und Epiphanien, sondern durch Jesu Tod am Kreuz. Das Kreuz als Zeichen der Christen – das sagt eigentlich alles.
Vielfach wurde und wird das Christentum als Sklavenreligion oder als Glaube der Schwachen verächtlich gemacht, ob im Sinne Nietzsches, philosophisch auftrumpfend, oder gedankenlos in der primitiven Logik eines KZ-Wärters oder eines Politkommissars. In jedem Fall wird dabei völlig verkannt, was mit der “Kraft aus der Höhe” (Lk 24, 49) gemeint ist, die Christus seinen Jüngern und allen Gläubigen zugesagt hat. Am Jüngerkries Jesu kann man erkennen was das bedeutet: die zutiefst verstörten, enttäuschen, verängstigten Jünger, die nach dem Tod ihres Meisters glaubten alles verloren zu haben und völlig am Ende zu sein, verwandelten sich durch die Begegnung mit dem Auferstandenen von heute auf morgen in frohgemute Bekenner und Missionare, die weder Tod noch Teufel fürchten. Und dieses Wunder hat sich im Laufe der Geschichte immer wieder ereignet.
Standhalten im Alltag
Aber die Gabe der Stärke ist nicht nur etwas für eine kleine Gruppe Auserwählter, und sie hilft nicht nur im Extremfall des Martyriums. Auch im ganz normalen, äußerlich “harmlosen” Alltag ist sie wichtig. In einer zunehmend unchristlichen und kirchenfeindlichen Umwelt brauchen wir mehr und mehr Mut und Kraft zum Bekenntnis.
Glaube ist niemals nur eine Privatsache, kein Hobby, oder etwas für das stille Kämmerlein; wir leben ihn immer in der Gemeinschaft der Kirche. Das Bekennen besteht dabei nicht nur darin, etwa als Missionar öffentlich aufzutreten, oder im Internet Furore zu machen; es gehört vielmehr schon Bekennermut dazu, dem Druck des Zeitgeistes im gewöhnlichen Alltag zu widerstehen, ob es nur um die Heiligung des Sonntags geht, oder um den Lebensschutz, ob beim Kirchgang oder in der Kindererziehung.
Der Hl. Johannes Paul II. formulierte es treffend: “Wenn dem Menschen die Kraft fehlt, angesichts höherer Werte, wie der Wahrheit, der Gerechtigkeit, der geistlichen Berufung, der ehelichen Treue, sich selbst zu überwinden, muss diese Gabe von oben aus jedem von uns einen tapferen Menschen machen…”[9]
Die Gabe der Stärke gibt uns unter anderem:
- Eine gewisse Leichtigkeit im Umgang mit Sorgen, Nöten und Leiden. Sie stärkt unsere Resilienz, schützt vor Burnout und Depression und macht uns fähig, eine positive Rolle in unserem Umfeld und in der Gesellschaft zu spielen.
- Sie gibt uns die Voraussetzung, Tugenden zu leben, insbesondere die Tugend der Tapferkeit. Zugleich fördert das Wissen um die Gegenwart des Heiligen Geistes unsere Demut und gibt uns Zuversicht.
- In Auseinandersetzungen um Glaubensfragen sind wir nicht allein oder nur auf uns gestellt, sondern können darauf vertrauen, was Jesus Christus uns zugesagt hat: “…der Geist eures Vaters wird durch euch reden” (Mt 10, 19f).
Bild: Ausgießung des Heiligen Geistes im Rabbula-Evangeliar (586)
[1]Das lat. Wort consilium bezeichnet sowohl den Ratschlag, als auch die Beratung bzw. das Beratungsgremium. Ähnlich verhält es sich mit dem altgr. Begriff Bulé (βουλή), der neben Wille und Absicht u.a. auch “Beschluss” / “Ratschluss” im o.g. Sinne bedeutet. Im alten Athen wurde als βουλή auch der “Rat der Fünfhundert” bezeichnet.
[2]In der „Septuaginta“ (LXX), der seit hellenistischer Zeit maßgeblichen Übersetzung der hebräischen Bibel ins Griechische. Die LXX können wir als den Ausgangspunkt der hier besprochenen Begrifflichkeit ansehen.
[3]Vgl. W. Bauer: Wörterbuch zu den Schriften des Neuen Testaments und der übrigen urchristlichen Literatur. Berlin / New York 1971. Sp. 289.
[4]Vgl. a. Carvajal, a.a.O. S. 351 f.
[5]Summa theologica, zit. nach Carvajal, a.a.O. S. 354.
[6]Vgl. den entsprechenden Beitrag aus der Artikelserie über die Kardinaltugenden: https://erziehungstrends.info/die-kardinaltugenden-3-tapferkeit-fortitudo
[7]Aussprache: Is-chýs.
[8]Phil 4, 13.
[9]Zit. nach Carvajal, a.a.O. S. 376. Hervorhebung von mir.