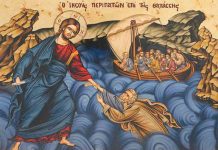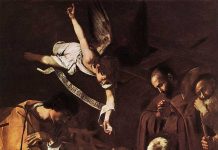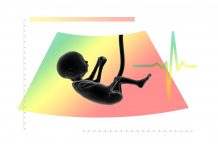Warum ist die Kirche so streng, wenn es um die Ehe geht? Kann sie nicht die Lebenswirklichkeit der Menschen berücksichtigen und sich entsprechend anpassen? Auch viele kirchliche Gemeinschaften haben das doch längst getan; warum beharrt die Katholische Kirche so sehr auf ihrem Eheverständnis? Für viele Zeitgenossen – auch innerhalb der Kirche – ist das schwer erträglich.
Beachtet endlich die Lebenswirklichkeit…?
Ehescheidung gilt zwar nicht gerade als etwas Schönes, immerhin zeugt jede Scheidung davon, dass eine Beziehung gescheitert ist, dass zwei Menschen – um es einmal ganz milde auszudrücken – ihrer einmal gegebenen Zusage nicht gewachsen sind. Das ist auch in unserer weithin permissiven Gesellschaft immer noch etwas Trauriges. Und richtig bitter wird es natürlich, wenn aus der Ehe schon Kinder hervorgegangen sind.
Aber trotzdem gehört das – so denken wir – irgendwie dazu, als „fact of life“, und niemand wird schief angesehen, weil er oder sie schon einmal geschieden wurde, womöglich auch schon mehrfach. Deshalb sehen wir gern ein wenig über die kirchliche Ehe-Lehre[1] hinweg, mit Achselzucken oder Kopfschütteln.
O-Ton Jesus
Dabei fällt Die Antwort auf die Frage, warum die Kirche hier so „streng“ ist, eigentlich leicht: Bei der Ehe geht es nicht um kirchliche Traditionen oder zeitgebundene Interpretationen, nicht um spirituelle Erfahrungen oder abgeleitete ethische Normen. Über die Ehe gibt es deutliche Aussagen von Jesus Christus selbst: „Wer seine Frau aus der Ehe entlässt und eine andere heiratet, begeht ihr gegenüber Ehebruch“[2].
Wie kam es zu dieser Aussage? Die Pharisäer hatten mit einer Frage versucht, Jesus eine Falle zu stellen: „Darf ein Mann seine Frau aus der Ehe entlassen?“. Das war eine Fangfrage, denn sie kannten Jesus und hatten genug von seiner Lehre mitbekommen, um zu wissen, wie er zu ihrer üblichen, schematischen Gesetzesauslegung stand.
Der oft hölzernen und formalistischen Auffassung der Pharisäer widersprach Jesus immer wieder; denken wir zum Beispiel an die Begebenheit mit der Frau, die auf frischer Tat beim Ehebruch erwischt worden war[3] (das Thema passt gut hierher): Die Schriftgelehrten und Pharisäer wollten sie steinigen. Und auch in dieser Situation stellten sie Jesus auf die Probe und wollten erreichen, dass er öffentlich dem Gesetz des Mose widerspreche.
In beiden Fällen reagiert Jesus nicht so, wie es die Scheinheiligen erwartet und gehofft hatten. Er lässt ihre Fangfrage jeweils ins Leere laufen; er antwortet nicht bzw. er stellt eine Gegenfrage.
Als heutige Leser und Hörer des Evangeliums sind wir irgendwie in der Zwickmühle. Natürlich sind wir froh und erleichtert, dass Jesus die Ehebrecherin rettet. Aber in dem anderen Fall schauen wir etwas blamiert und verunsichert drein. Wie kann er denn die Ehescheidung verbieten?
Wie kann er das tun?
Er kann es aus seiner göttlichen Vollmacht heraus. Schauen wir einfach noch einmal hin:
Jesus antwortet den Pharisäern mit der Gegenfrage: „Was hat euch Mose vorgeschrieben?“ Damit entlarvt er die Unaufrichtigkeit der Frager, die doch genau wussten, was das Gesetz besagte; und sie antworten auch noch brav und triumphierend: „Mose hat erlaubt, eine Scheidungsurkunde auszustellen und die Frau aus der Ehe zu entlassen“.
Sie wussten um Jesu Liebe zu den Schwachen und Benachteiligten, und sie konnten aus gutem Grund erwarten, dass er sich auf die Seite der Schwächeren in diesem Rechtsgeschäft stellen würde, auf die Seite der verstoßenen Frauen. Und damit hätte er nach ihrer Auffassung dem mosaischen Gesetz widersprochen, wofür sie ihn dann anklagen könnten.
Und tatsächlich spricht Jesus als der, der über Mose und dem Gesetz steht. Hier – genau wie bei dem Vorfall mit der Ehebrecherin – erweist er sich einmal mehr als der „Sohn des lebendigen Gottes“[4]. Er ist mehr als nur ein kluger Rabbi und frommer Wanderprediger. In dieser Situation müssen die Pharisäer das irgendwie gespürt haben, denn sie lassen noch einmal von Jesus ab, wenn auch gewiss widerwillig und verunsichert.
Aber zurück zum Gebot Jesu. Geht es uns heute nicht ganz ähnlich? Sind wir nicht auch verunsichert, womöglich gar widerwillig beim Anhören seines Verdikts über die Scheidung? Denken wir nicht: „das kann man doch heute nicht mehr sagen…“?
Und was ist mit dem Gesetz?
Jesus lässt sich nicht auf eine Diskussion über Details der Gesetzesauslegung ein; er geht stattdessen der Sache auf den Grund: Der Grund für den „Dispens“ des Moses ist die Hartherzigkeit der Menschen: „nur weil ihr so hartherzig seid, hat er euch dieses Gebot gegeben“. Wie ist das zu verstehen?
Die Scheidungsregelung des mosaischen Gesetzes war quasi eine Schutzbestimmung für die Frauen; sie schützte sie davor, von ihren Gatten einfach abgelegt zu werden, wie eine nicht mehr gewollte Sache. Die „Scheidungsurkunde“ sollte das Schlimmste verhindern, verstoßenen Frauen eine Berufungsgrundlage gegen hartherzige Ehemänner geben. Jesus geht natürlich nicht dahinter zurück, sondern er geht viel weiter, zeigt auf, wie es ohne Hartherzigkeit geht und wie Gottes Wille wirklich zur Geltung kommt!
Mit dem mosaischen Scheidungsrecht ist es ein wenig wie beim sog. „Talionsrecht“ („Auge um Auge, Zahn um Zahn“), Auch das forderte nicht das Ausschlagen von Zähnen und Augen als formelle Strafe, sondern es sollte verhindern, dass wegen eines kleinen Vergehens unmäßig zurückgeschlagen wurde. Es sollte sozusagen niemand wegen eines zerbrochenen Zahnes den Schuldigen totschlagen dürfen. Und so ist es auch hier: Begrenzung des Übels durch Regeln, im Wissen um das Böse in den Menschen. Damit wird Verhältnismäßigkeit hergestellt und das Schlimmste verhütet, und damit wird eben nicht eine Befreiung aus der Verantwortung gewährt.
Der mosaische Scheidebrief zeugt vom Zustand der gefallenen Menschheit. Jesu Worte spiegeln dagegen die gottgewollte Schöpfungsordnung.
Rechtsordnung und Schöpfungsordnung
Mit dem Rückgriff auf die Schöpfungsordnung macht Jesus deutlich, wie es sein soll: „Am Anfang der Schöpfung hat Gott sie als Mann und Frau geschaffen“. Und: „sie werden ein Fleisch“ sein. Und weiter: „Sie sind also nicht mehr zwei, sondern eins. Was aber Gott verbunden hat, das darf der Mensch nicht trennen“ (diesen letzten Satz hören wir bei jeder kirchlichen Trauung).
In den Worten Jesu steckt aber noch mehr, das in unserer Gegenwart hochaktuell ist:
Hierin steckt implizit eine klare Absage an „gleichgeschlechtliche Ehen“ und ebenso an jede Art „posthumanistischer“ Leugnung der biologischen Geschlechter.
Auch Leibfeindlichkeit und Puritanismus erfahren hier eine Absage, denn „ein Fleisch sein“ meint natürlich Sex. Und das lesen wir ja schon in der Schöpfungsgeschichte (Gen 2, 18-24), in deren wunderbar farbiger und poetischer Redeweise die gottgewollte und privilegierte Beziehung zwischen Mann und Frau in ihrer Leiblichkeit zum Ausdruck kommt.
Vor allem aber: Es sind diese Worte Jesu, die den Wert der Ehe bestätigen, ihre Heiligkeit und auch ihren sakramentalen Charakter. Die Ehe ist keine gesellschaftliche Verfahrensordnung praktischer Art, sondern ein direkter Ausfluss der göttlichen Schöpfungsordnung.
Kein Raum für Halbherzigkeiten
Wir stehen damit vor der Frage: Geben wir uns zufrieden mit den Dingen, so wie sie nun mal geworden sind? Ist uns „Auge um Auge“ und „Recht auf Scheidung“ lieber als die gottgewollte Schöpfungsordnung? Wenn wir versucht sind, dem Trend der Zeit folgend über Jesu Worte hinwegzugehen oder sie wohlfeil umzudeuten, dann sollten wir an die Frage denken, die Jesus an anderer Stelle seinen Jüngern stellt: „Wollt auch Ihr weggehen?“[5] Trauen wir uns, mit den Worten des Petrus zu antworten, auch wenn es manchmal schwerfällt: „Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens“!
[1]Katechismus der Katholischen Kirche, Nr. 2382 ff.
[2]Vgl. Mk. 10, 2-12
[3]Joh. 8, 3 ff.
[4]Mt. 16, 16.
[5]Vgl. Joh. 6, 67 ff