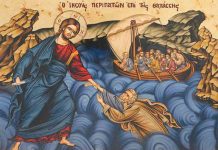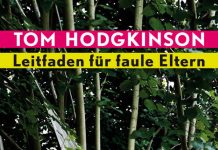Frömmigkeit (Pietas / εὐσέβεια[1])
Eine Doublette?
Die siebte Gabe des Heiligen Geistes könnte uns nach dem bisher Gesagten überraschen: Das hatten wir doch schon! Ist das nicht identisch mit „Gottesfurcht“? Die lateinischen und griechischen Ausdrücke belegen das doch, auch wenn es im Deutschen zwei Wörter gibt, oder? Außerdem finden sich in unserem Bezugstext im Buch Jesaja, bei der großen messianischen Schau des Propheten, nur die sechs schon behandelten Geistesgaben. Wieso kommt also jetzt noch einmal die „Frömmigkeit“? Und worin liegt der Unterschied zur „Gottesfurcht“ bzw. was kommt noch hinzu?
Quintessenz der Gaben
Das deutsche Wort „Frömmigkeit“ hat eine etwas andere, weitere Konnotation als das altgriechische „Eusébeia“[2]. Und in freier Auslegung des Begriffes können wir sagen, dass darin die wesentlichen Elemente der anderen sechs Gaben des Heiligen Geistes zusammenfließen. Ein Leben in echter Frömmigkeit setzt voraus: Dass wir mit Weisheitund Einsicht beschenkt werden, Rat und Stärke empfangen und deshalb aufgrund der rechten Erkenntnis in Gottesfurchtleben. Es zeichnet sich hier so etwas wie ein Weg des rechten Lebens ab, eines Lebens in Frömmigkeit im ursprünglichen Wortsinn.
Fromm, frömmer, Frömmler…?
Worte wie „fromm“ und „Frömmigkeit“ haben heute im Umgangssprachlichen selten einen ganz positiven Klang. Bestenfalls denkt man an irgendwie weltfremde, etwas zaghafte Zeitgenossen, die der Realität des Lebens nicht so richtig gewachsen sind und sich deshalb hinter Kirchenmauern flüchten. Schlimmstenfalls fällt uns das Zerrbild des „Frömmlers“ ein, der sich arglistig hinter einer anständigen Fassade verbirgt und in Wirklichkeit schamlos und selbstsüchtig[3] ist. Und gerade dieser Typ des Frömmlers ist keineswegs ausgestorben; er mischt vielmehr in Politik und Öffentlichkeit wieder kräftig mit – allerdings in komplett säkularisierter Form, als moralisierender Spielverderber, mit einer politischen „hidden agenda“.
Wiederentdeckung des Heiligen
Wie es dazu kam, dass ein ursprünglich so positiv besetzter Begriff wie „Frömmigkeit“ abgenutzt und beinahe ins Gegenteil verkehrt werden konnte, darüber ließen sich ganze Bücher schreiben[4]. In letzter Zeit zeigt sich aber gerade in unseren säkularisierten Gesellschaften in Europa ein interessantes Phänomen: Junge Leute entdecken den Glauben neu, erfahren darin nicht nur Trost und Stärkung, sondern fühlen sich erhoben zu einer ganz neuen Sicht der Dinge und einem erfrischend anderen Lebensgefühl, jenseits des materialistischen Mainstream. Das weckt in ihnen positive Energie, Begeisterungsfähigkeit und guten Willen. Wenn das nicht Gaben des Heiligen Geistes sind!
Heiligung des Alltags
Die Frömmigkeit als Gabe des Heiligen Geistes hat viele heilsame Wirkungen[5], die uns dabei helfen, unser ganz normales Leben in Familie, Beruf, Gesellschaft zu „heiligen“, ohne dass wir dadurch Frömmler werden bzw. sonderbar oder weltfremd. Ganz im Gegenteil, wir können dann viel besser „mitspielen“ im täglichen Getriebe und das auch unter widrigen Bedingungen:
- Die recht verstandene Frömmigkeit stärkt unser Selbstgefühl und macht uns widerstandsfähig in Anfechtungen, Krisen, Schmerz und Leid. Sie reduziert die Anfälligkeit für Depressionen und andere psychische Leiden[6].
- Sie stärkt den Zusammenhalt der Ehen und Familien, hilft bei der Kindererziehung, fördert Uneigennützigkeit, Menschlichkeit, Nächstenliebe.
- Sie fördert in uns die Tugenden, sowohl die sog. Kardinaltugenden[7], als auch die „göttlichen“[8] und hilft uns dabei, in Kirche und (säkularer) Gesellschaft nützlich und hilfreich zu sein.
- Vor allem aber – und davon gehen alle anderen guten Wirkungen aus – regelt und stärkt die Frömmigkeit unser Verhältnis zu Gott und hilft uns dabei, täglich im Bewusstsein unserer „Gotteskindschaft“ zu leben.
Nicht nur zum Pfingstfest
In Vorbereitung auf das Pfingstfest, aber auch sonst, das ganze Jahr hindurch, ist es gut und heilsam, sich im Gebet an den Heiligen Geist zu wenden. Er ist der von Christus angekündigte „Tröster“ und „Anwalt“[9], der uns nicht nur zu überleben ermöglicht, also irgendwie „durchzukommen“, sondern uns dazu befreit, regelrecht über uns hinaus zu wachsen. Ein sehr schönes Gebet[10] kann dabei helfen, die Hinwendung zur Dritten Person der Trinität, dem Heiligen Geist, wiederzubeleben:
Komm, Heiliger Geist!
Erleuchte meinen Verstand, damit ich deine Gebote erkenne.
Stärke mein Herz gegen die Nachstellungen des Feindes.
Entflamme meinen Willen…
Ich habe deine Stimme vernommen und möchte mich nicht verhärten und dir widerstehen. Ich will nicht sagen: Morgen… Nunc coepi! Jetzt beginne ich – denn es könnte kein Morgen mehr für mich geben.
Oh Geist der Wahrheit und der Weisheit, Geist des Verstandes und des Rates, Geist der Freude und des Friedens: Ich will, was du willst, ich will, weil du willst, ich will, wie du willst, ich will, wann du willst.
Bild: El Greco – Herabkunft des Heiligen Geistes
[1]Es gibt im Griechischen auch noch den fast synonymen Begriff „Theosebeia“ (θεοσέβεια) was wörtlich „Gottesverehrung“ bedeutet, während „Eusebeia“ (εὐσέβεια) eigentlich „gute“ bzw. „richtige“ Verehrung heißt, wobei natürlich klar ist, dass sich diese hier auf Gott bezieht. Über den Begriff der Ehrfurcht vgl. auch: Romano Guardini: Tugenden. Meditationen über Gestalten sittlichen Lebens. Paderborn 1987. S. 57 ff.
[2]In diesem Wort (εὐσέβεια) klingt „sébas“ (σέβας) „heilige Scheu“ oder „Erhabenheit“ bzw. „Heiligkeit“ an. Dagegen ist die Wurzel des deutschen Wortes „Frömmigkeit“ im althochdeutschen „frumicheit“ zu finden, was man mit „Tüchtigkeit“ oder „Tapferkeit“ übersetzen kann (von ahd. „fruma“, was „Vorteil“ oder „Nutzen“ bedeutete).
[3]Molière hat diesem Typus mit seinem „Tartuffe“ ein Denkmal gesetzt bzw. ein Warn-Schild aufgerichtet.
[4]Ein lesenswerter Klassiker: Charles Taylor. Ein säkulares Zeitalter. Deutsche Ausgabe Frankfurt 2009.
[5]Vgl. a. Carvajal, a.a.O. S. 360 ff.
[6]Das ist u.a. auch in medizinischen Studien in etlichen Ländern mehrfach belegt.
[7]Vgl. https://erziehungstrends.info/category/kardinaltugenden
[8]Vgl. https://erziehungstrends.info/category/theologische-tugenden
[9]„Paraklet“ (παράκλητος / parákletos), wörtlich: der zur Unterstützung Herbeigerufene.
[10]Vom Hl. Josefmaria Escrivá.