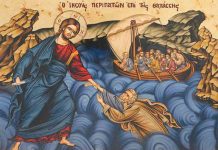Weisheit (sapientia / σοφία)
Es fängt gleich mit einem Höhepunkt an: „Weisheit“ erscheint uns als ein schwer erreichbarer Gipfel geistigen Strebens und lebenslanger intellektueller Entwicklung. Das scheint nichts für Jedermann zu sein, eher eine Ausnahmeerscheinung, vor der alle Hochachtung haben müssen. Ein ganzes Buch der Bibel[1] trägt diesen Namen, ebenso manche Universitäten[2].
Keine Frage des Alters…
Denken wir an weise Menschen, dann haben wir in der Regel würdige Greise und ehrwürdige Mütter vor Augen, wobei keinesfalls jeder Gelehrte und jede Professorin, selbst auf dem Höhepunkt ihres Schaffens, diesen Ehrentitel verdient. Überhaupt hängt Weisheit – wir wissen das intuitiv – nicht an Titeln und gesellschaftlichen Würden; man hat darauf keinen Anspruch.
… oder des Fleißes
Das landläufige und durchaus treffende Verständnis von Weisheit geht von einer Mischung aus Wissen, Erfahrung und Charakterstärke aus, immer mit etwas kritischer Distanz zum „Mainstream“. Ob aber aus diesen Zutaten wirklich so etwas wie Weisheit wird, das hängt offenbar noch von anderen Faktoren ab. Weisheit lässt sich nicht erzwingen, sie ist mehr als nur akkumuliertes Wissen und Erfahrung; ein Vielwisser ist noch lange nicht weise, und vielen Alten geht leider jede Weisheit ab. Dagegen kann eine junge Frau, die noch vor Erreichen ihres fünfundzwanzigsten Lebensjahres verstarb, zur Kirchenlehrerin erhoben werden. Die heilige Thérèse von Lisieux hat gewiss auch übermenschlich scheinende Mühen auf sich genommen; die Weisheit aber wurde ihr geschenkt. Weisheit ist eben mehr als das Produkt unserer Talente und Anstrengungen; es kommt immer ein spirituelles Element dazu.
Geschenk und Gnade
Und damit sind wir auf der Spur dessen, was hier mit „Gabe des Heiligen Geistes“ gemeint ist. Die Weisheit, die der Heilige Geist auch uns normalen Leuten zu geben verspricht, kann ganz unspektakulär wirken. Sie ist auch nicht nur eine Sache des Intellektes, sondern eine Gnade, ein „Erleben des Herzens“[3], so dass wir bewusst, aber ohne Anstrengung, in der Gegenwart Gottes leben können, mitten im Alltag. Mit den Worten des Hl. Josefmaria gesagt ermöglicht es uns diese Gabe, „in Wahrheit die Situationen und Geschehnisse unseres Lebens zu beurteilen“[4].
Wie wirkt sich das aus?
Weisheit ist gesellschaftlich und umgangssprachlich immer gut „konnotiert“; da gibt es keine Einschränkungen oder Bedenken, ganz egal in welchem Zusammenhang davon die Rede ist. Aber wie steht es mit der Relevanz für das Leben ganz normaler Menschen? Genau hier kommt die Gabe des Hl. Geistes ins Spiel: In diesem Sinne weise zu handeln bedeutet, das als richtig Erkannte nach Maßgabe der Tugenden[5] auch umzusetzen. Mit anderen Worten:
- Die Gabe der Weisheit durch den Hl. Geist ist performativ[6], sie gibt unserem Denken und Handeln Orientierung, die Ausrichtung auf das dem göttlichen Willen Gemäße, und sie lässt uns aktiv werden.
- Im Kognitiven hilft sie uns bei der „Scheidung der Geister“, einer in Zeiten überbordender sozialer Kommunikation mit all ihren ideologischen Zwängen und Verirrungen, Fake News und Propaganda geradezu lebensnotwendige Fähigkeit.
- Und im Emotionalen hilft uns die „göttliche Weisheit“, alle Dinge sub specie aeternitatis[7] zu sehen, was unsere Resilienz gegenüber Anfechtungen, Scheitern und Leiden stärkt.
Einsicht (intellectus / σύνεσις)
Gleich nach der Weisheit ist nun von jener Gabe die Rede, die wohl die wichtigste Voraussetzung zum Erwerb von Weisheit ist: „Einsicht“, oder auch „Verstand“[8]. Das zielt aber weniger auf das mentale Vermögen[9] zu denken, zu urteilen und zu schließen, als vielmehr auf das tatsächliche Wahrnehmen und Verstehen, Erkennen und Merken. Eine Geistesleistung also, die jedem Erwerb von Wissen und Verständnis zugrunde liegt.
Das altgriechische Wort Synesis (σύνεσις)[10] kann im antiken Sprachgebrauch auch das Zusammentreffen, die Vereinigung bedeuten, zum Beispiel den Zusammenfluss zweier Gewässer. So erkennen wir, worum es geht: Das Bilden eines vernünftigen Urteils (auch das vernunftgemäße Handeln) unter Heranziehung, richtiger Deutung und gerechter Berücksichtigung aller wesentlichen Elemente. Das klingt so einfach, ist aber keineswegs selbstverständlich; viel Unglück geschieht in der Gesellschaft und im Leben des Einzelnen aufgrund fehlerhafter, unzureichender, verfälschter Wahrnehmung und Deutung der Dinge.
In guter Gesellschaft
Wenn wir um diese Gabe des Heiligen Geistes bitten, befinden wir uns gewissermaßen auf Augenhöhe mit König David, dessen Bitte lautete: „Gib mir Einsicht, damit ich Deiner Weisung folge und mich an sie halte aus ganzem Herzen“ (Ps. 119, 34). Auch Salomo kann man hier anführen, von dem eine besonders schöne Formulierung überliefert ist. Gott stellte ihm einen Wunsch frei, aber er bat nicht um Macht, Ruhm oder Reichtum, sondern erwies sich als der Weise, als den wir ihn kennen: „Verleih Deinem Knecht ein hörendes Herz, damit er Dein Volk zu regieren und das Gute vom Bösen zu unterscheiden versteht“.[11]
Das ist nicht nur für Herrscher und Mächtige eine gute Maxime, sondern auch für ganz normale Menschen in ihrem Alltagsleben. Salomo trifft den Kern dessen, was die Gabe der Einsicht oder des Verstandes ausmacht: Nicht das kühle technokratische Können des „Machers“ ist gemeint, nicht der utilitaristische Wille zur Perfektion um ihrer selbst (oder unseres materiellen Vorteils) willen, sondern die tiefere Einsicht in das Richtige, das der Schöpfungsordnung Gemäße.
Wozu können wir das heute gebrauchen? Was kann uns das geben?
- Die Gabe der Einsicht befreit uns aus der Gefangenschaft von Ideologien und Manipulationen, Meinungs-„Blasen“ und Entmündigung. Das ist in einer Zeit äußerst wichtig, in der Menschen durch Meinungsdruck dazu gebracht werden, Vernunftwidriges, offensichtlich Unsinniges zu akzeptieren und zu wiederholen.
- Ohne rechte Einsicht und die Kraft zum Gebrauch unseres (gottgegebenen) Verstandes könnten wir nie das Potential ausschöpfen, das in uns steckt. Kreativität, aber auch Anstand und Gerechtigkeit blieben auf der Strecke.
- Eine wahre Gottesgabe, von der leider sehr viele Menschen keinen Gebrauch machen, ist die intellektuelle Redlichkeit. Ohne sie gibt es weder Fortschritt noch Frieden. Wir alle sind doch leicht versucht, die Fakten so darzustellen, dass wir selbst und unsere Sicht der Dinge gut aussehen[12]. Die Gegenmeinung findet allzu oft keine angemessene Darstellung, wodurch im Diskurs am Ende beide Seiten verlieren.
Bitten wir also um den Geist der Weisheit und der Einsicht!
Bild: Pfingsten, Salvador Dali 1964
[1]Das Buch der Weisheit bzw. der Weisheit Salomos.
[2]Zum Beispiel die „Sapienza“ in Rom, oder die Sophia Universität in Tokyo. Vom lateinischen Wort sapientia bzw. vom altgriechischen σοφία (Sophia).
[3]Francisco F. Carvajal / Josef Arquer: Meditationen für jeden Tag. Köln 1991. Bd. 3 Osterzeit, S. 347.
[4]Zit. nach Carvajal, a.a.O. S. 346.
[5]Was das im Einzelnen bedeutet, ist auf zeitlose Art in den klassischen „Tugenden“ beschrieben. Vgl. hierzu die Serie zu den Kardinaltugenden: https://erziehungstrends.info/kardinaltugenden-klugheit
[6]Aktiv das umsetzen, was enthalten bzw. was logisch als Umsetzung zu folgern ist. Vom lateinischen Wort performare, völlig bilden, gänzlich formen.
[7]Unter dem Aspekt der Ewigkeit, d.h. mit Blick auf den Sinn des Lebens, die Verantwortung vor Gott, die Quelle alles Guten, die Überwindung der Vergänglichkeit. Mit den Worten der Hl. Edith Stein: Angesichts des ewigen Seins.
[8]Vgl. Carvajal, a.a.O. S.327 ff., Nr. 41.
[9]Lat.: mens, mentis (f.). Vgl. Georges, Kleines deutsch-lateinisches Handwörterbuch. Hannover 1997.
[10]Das Wort wird in der Septuaginta an der betr. Stelle Jes. 11, 2 verwendet.
[11]Diese Stelle aus dem Buch der Könige (1 Kön 3, 9) zitierte Papst Benedikt XVI. in seiner berühmten Rede vor dem Deutschen Bundestag im September 2011: https://www.bundestag.de/parlament/geschichte/gastredner/benedict/rede-250244
[12]Das ist auch bekannt als „Straw Man Argument“: Man stellt die Gegenposition verzerrt, übertrieben, von vorneherein abwertend dar (baut einen „Strohmann“ auf, den man dann angreifen kann), um sich die Argumentation dagegen zu erleichtern und keine eigenen gedanklichen Schwächen zugeben zu müssen. Das Gegenteil ist das „Strong Man Argunment“, womit man die Gegenposition vollständig, korrekt und mit dem guten Willen vorstellt, alles Positive zur Geltung zu bringen; erst danach präsentiert man die Gegenargumente. Diese höchste Form der intellektuellen Redlichkeit findet man in perfekter Ausführung durchgängig in den Werken von Josef Ratzinger / Benedikt XVI.