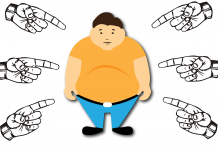…
Unsere Gesellschaft ist weithin – um es mit einem prägnanten Ausdruck von Jürgen Habermas auszudrücken – „religiös unmusikalisch“. Nicht unbedingt aggressiv anti-religiös, aber nur begrenzt interessiert und allergisch gegen Frömmigkeit.
Dazu scheint das Religiöse zu subjektiv und unklar zu sein, Gott irgendwie weit weg, einfach nicht konkret genug. Manche Leute finden, dass sich Gott klarer ausdrücken müsste in der Welt. Er möge sich einfach ein wenig deutlicher zeigen, dann könnte man auch leichter an ihn glauben…
Zu viel für unsere Nerven?
Dass es für uns Menschen nicht so einfach ist, Gott quasi „auf Augenhöhe“ zu begegnen, ist allerdings kein Phänomen der postmodernen Gesellschaft, sondern eine uralte Menschheitserfahrung. Im Alten Testament findet sich ein beeindruckender Bericht: Mose begegnet Gott auf dem Berg, aber er darf sein Gesicht nicht sehen, weil er das nicht überleben könnte (Ex. 33, 20ff).
Eine etwas unheimliche Begegnung, die nicht gerade dem entsprechen dürfte, was unsere Zeitgenossen an Plausibilität erwarten. Trotz der unheimlich direkten Gottesbegegnung des Mose mussten sich auch die Israeliten seinerzeit auf das Wort und die Erfahrung des Propheten verlassen, und sie waren offenbar zufrieden damit, weil sie wussten, dass es so besser für sie war.
Was aber, wenn man gar kein Interesse an der Begegnung mit Gott hat? Täuschen wir uns nicht – diese Haltung ist nicht neu, kein Produkt der Aufklärung, der Moderne oder Postmoderne. Unabhängig vom Lippenbekenntnis leben immer schon zahllose Menschen „etsi Deus non daretur“, so als gebe es keinen Gott, keine Verantwortung vor ihm und auch keine göttliche Liebe[1].
Entgegenkommen statt Überwältigung …
Ein von mir sehr geschätzter Pfarrer liebt es, seine Zuhörer in der Predigt mit überraschenden Sätzen aufzurütteln. So schloss er einmal eine Predigt zum Thema Nächstenliebe mit dem Aufruf: „Mach es wie Gott – werde Mensch!“ Damit traf er ins Schwarze, bietet doch keine andere Religion den Menschen einen so konkreten Zugang zu Gott – eben weil Gott den Menschen bei ihrer Suche entgegen kommt.
Was Mose auf dem Berg noch verwehrt geblieben war, das wurde durch Jesus endlich möglich – und nicht nur für einen Auserwählten. Dieses eine Mal, dieses unvergleichliche und unwiederholbare einzige Mal war Gott dann doch ganz „physisch“ präsent, ein Gott zum Anfassen, im wahrsten Sinne des Wortes. Seither ist es allen Menschen eigentlich viel leichter geworden, sich Gott „vorzustellen“. In Jesus Christus trat er vor ihre Augen.
Aber andererseits scheint es bei Jesus doch wieder so wie im Alten Testament zu gehen: Schon seine Geburt geschieht nicht als kosmisches Großereignis, sondern unscheinbar, in einem Unterschichtsambiente, fast wie ein Notfall, im Stall…Später weigert er sich mehrfach, seine Göttlichkeit und Autorität mittels dramatischer Zeichen zu beweisen, obwohl das für seinen öffentlichen „Erfolg“ sicher von phänomenaler Wirkung gewesen wäre (vgl. z.B. Lk 11,29).
Und wenn er Wunder tut, dann oft fast im Geheimen. Wieder gibt es keine überwältigenden, physisch eindeutigen Manifestationen, die auch den letzten Zweifler mitreißend überzeugen müssten. Darin immerhin zeigt sich beeindruckende Konsequenz: Gott will offenbar nicht, dass die Menschen überwältigt werden; sie sollen sich entscheiden können und nicht „ferngesteuert“ unbewusst dahin vegetieren, wie in dem Hollywood-Film „Matrix“, in dem sie unter einer kalten Roboterherrschaft mit einem täuschend echt wirkenden, aber rein virtuellen „Bewusstsein“ ausgestattet ihres Willens und ihrer Freiheit beraubt sind.
Schnittstelle zum Absoluten
Die Menschen haben es nicht so ohne weiteres akzeptiert, dass Gott endlich auf gefahrlose, dafür aber äußerlich eher unspektakuläre Weise „fassbar“ wurde. War die Menschwerdung Gottes doch wieder nur nur ein vorübergehendesPhänomen, so wie Gott an Mose vorübergegangen ist?
Nach der Lehre der Kirche ist Christus aber auch nach Tod und Auferstehung nicht wieder „weg“ oder einfach „jenseits“, sondern in einer Weise in unserer Realität weiterhin präsent, die bei uns einen ähnlichen Schauer der Ehrfurcht auslösen sollte, wie ihn seinerzeit Mose auf dem Berg empfunden haben muss: In der Eucharistie, in der geweihten Hostie ist Christus nicht nur symbolisch, indirekt, gedanklich, zeichenhaft oder sonst „irgendwie“ präsent, sondern tatsächlich, real, physisch[2].
Die einzigartige Möglichkeit Gott zu berühren gibt es also heute noch! Zwar entzieht sich diese geheimnisvolle Gegenwart unseren technischen Messverfahren. Dafür wirkt sie aber unaufhörlich und ist immer wieder und unbegrenzt wiederholbar.
In den Kategorien unserer technischen Zivilisation könnte man diese reale Präsenz mit einem „Interface“ vergleichen, einer echten Schnittstelle zu Gott, außerdem einer, die wir selbst aktivieren können (zumindest die Priester). So wird auch verständlich, warum die Katholische Kirche (und die orthodoxen Kirchen) seit jeher so viel Wesens macht um die Messfeier, und warum sie als „Mitte der Kirche“[3] bezeichnet wird.
[1] Vgl. Beitrag zur theologischen Tugend Liebe.
[2]Vgl. auch die Enzyklika „Lumen Fidel“ von Papst Franziskus, Nr. 31 (Ausgabe St. Benno Verlag, S. 59): „Mit seiner Inkarnation, mit seinem Kommen in unsere Mitte hat Jesus uns berührt, und durch die Sakramente berührt er uns auch heute.“
[3]Vgl. z.B. die Enzyklika „Ecclesia de Eucharistia“ von Papst Johannes Paul II. von 2003.