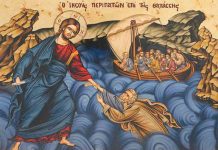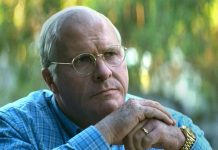Wir sind daran gewöhnt nach dem Nutzen der Dinge zu fragen, und das ist auch durchaus legitim. Unsere Zeit ist knapp, alle sind immer irgendwie beschäftigt, und selbst die Freizeit muss optimiert werden. Kirchliche Feste und Feiertage werden dabei nicht ausgespart und ebenfalls der kritischen Frage unterworfen: „was bringt mir das?“ Gerade in der Zeit vor dem Pfingstfest ist es angebracht, einmal eine klare Antwort auf diese Frage zu geben. Schütteln wir also nicht den Kopf über allzu utilitaristisches Denken, sondern laden wir einfach einmal zu einem kritischen Challenge ein: Wetten dass es sich lohnt?
Diese Feiertage mit dem komischen Namen[1] haben es in sich! Pfingsten ist das dritte große Fest aller Christen, nach Weihnachten und Ostern, und es verdient nicht weniger Aufmerksamkeit. In Deutschland werden alle drei Hochfeste mit zwei Feiertagen begangen; schon diese belanglos erscheinende Alltagswirklichkeit könnte ausreichen, um auch gänzlich unerfahrene Betrachter die Bedeutung des Festes erkennen zu lassen. Und es hat selbst drei wesentliche Aspekte: Es ist das Fest des Heiligen Geistes, das Gründungsfest der Kirche und die Grundlage der Weltmission.
Aller guten Dinge sind drei
Unsere Sprache enthält eine Menge verborgener Weisheit und kollektiver Erfahrungen, über die wir uns beim Reden nicht immer Rechenschaft ablegen. In sehr vielen Fällen scheint dabei die christliche Prägung unserer Kultur und unseres Denkens durch. So auch bei dem Sprichwort, dass aller guten Dinge drei seien. Dahinter steht die grundlegende Erfahrung des christlichen Glaubens[2], dass Gott einer ist, in drei Personen – Vater, Sohn und Heiliger Geist. Das Pfingstfest ist der Moment, uns des Heiligen Geistes[3] bewusster zu werden, dessen Wirken uns oft nicht genügend präsent ist.
Happy Birthday, Church!
Die Apostelgeschichte berichtet über die Ausgießung des Heiligen Geistes (Apg. 2 passim), was von Jesus während seines irdischen Wirkens mehrfach angekündigt worden war. Erst mit dem Kommen des Heiligen Geistes ist die göttliche Offenbarung vollständig. Und das war nicht ein isoliertes Geschehen in der Vergangenheit; gerade in der Person des Heiligen Geistes ist uns Gott zu allen Zeiten nahe, selbst wenn wir nichts davon merken. Und er hat so einiges anzubieten…
Was sind „Gaben des Heiligen Geistes“?
Was damals die Apostel gemerkt haben – dass der Heilige Geist ihr Wirken überhaupt erst möglich machte – das haben Christen zu allen Zeiten und aller Kulturen gespürt, und das geschieht auch heute immer wieder. Diese ermutigende und stärkende Erfahrung steckt hinter der Rede von den „Gaben des Heiligen Geistes“. Dabei handelt es sich nicht um ein kirchliches Dogma, es ist kein glaubensnotwendiges Faktum, aber doch Ausdruck einer tiefen Gotteserfahrung über die Jahrhunderte. Es lohnt sich, das einmal genauer zu betrachten.
Schon Jesaja wusste das
Die klassische Auflistung der Gaben des Hl. Geistes geht bis auf den alttestamentlichen Propheten Jesaja zurück. In einer großen eschatologischen Schau des erwarteten Messias zählt er sechs der uns bekannten sieben Gaben auf: Weisheit und Einsicht, Rat und Stärke, Erkenntnis und Gottesfurcht (Jes. 11, 2). Hinzu kommt in der abendländischen Tradition stets die Frömmigkeit[4], die in gewisser Weise die Quintessenz der sechs anderen enthält.
Diese messianische Vision des Propheten Jesaja ist im Übrigen auch einer der zahlreichen Belege für die Einheit von Altem und Neuem Testament – nicht nur philologisch gesehen, im Sinne der inhaltlichen Bezogenheit und zeitlichen Abfolge. Vielmehr gehört diese berühmte Stelle im Buch Jesaja zu jenen wichtigen Passagen des Alten Testaments, die über den Verständnishorizont ihrer Verfasser im alten Israel hinaus reichten[5] und erst im Nachhinein verständlich wurden, weil sie ihr eigentliches Ziel in Christus haben. Aber zurück zu der Sache mit den Gaben.
Wie gemacht für das 21. Jahrhundert
Die sieben Gaben des Hl. Geistes sind alles andere als antiquiert oder überholt. Sie zeugen vielmehr, heute wie vor zweitausend Jahren, von der helfenden Hand Gottes in unserer Welt. Und wenn wir uns darauf einlassen, werden wir überrascht feststellen, wie hilfreich und tröstlich das sein kann – in Familie und Beruf, im Alltagsleben und in Lebenskrisen, gegenüber unseren Nächsten, bei der Arbeit und in der Freizeit, im Umgang mit sozialen Medien, mit künstlicher Intelligenz und mit natürlicher.
Bei der Betrachtung der sieben Gaben halten wir uns an die Zusammenstellung des Propheten Jesaja; er hat sie praktischerweise schon in Paaren zusammengefasst. Also los – machen wir uns ans Auspacken dieser Geschenke!
(Wird fortgesetzt)
[1]Das Wort „Pfingsten“ geht auf das altgriechische Wort πεντήκοντα („pentékonta“) für die Zahl fünfzig zurück und bezeichnet den fünfzigsten Tag nach Ostern.
[2]Katechismus der Katholischen Kirche, Nr. 232 ff. Vgl. a. den Beitrag https://erziehungstrends.info/ein-gott-in-drei-personen-ist-das-zu-kompliziert
[3]Vgl. hierzu insgesamt die Enzyklika von Papst Johannes Paul II. DOMINUM ET VIVIFICANTEM, über den Heiligen Geist im Leben der Kirche und der Welt: https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/de/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_18051986_dominum-et-vivificantem.html
[4]Vgl. Katechismus der Katholischen Kirche, Nr. 1831.
[5]Vgl. hierzu vor allem Joseph Ratzinger / Benedikt XVI.: Jesus von Nazareth. Bd. 1. 2006