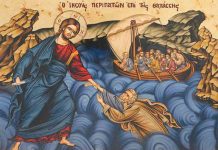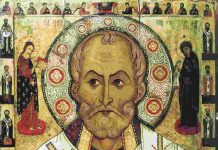Dass er den Namen jenes Apostels Jesu trägt, der oft als der zweifelnde, skeptische bezeichnet wird, gar als der ungläubige Thomas, das hat etwas von feiner Ironie. Nach dem Vorbild jenes überaus vorsichtigen und vernunftgeleiteten Apostels legte Thomas von Aquin[1] als Theologe und Philosoph stets den Finger in die Wunde und ließ nichts unversucht, was der menschliche Verstand überhaupt ergründen kann.
Vernunft und Glaube
Das typische Merkmal seines Werkes ist die Verbindung von Glaube und Wissen, tiefer Frömmigkeit und strenger Vernünftigkeit in allen Dingen. Thomas’ Denken beruhte auf dem Wissen um die Erkennbarkeit der Dinge, deren Vernünftigkeit[2] daher rührt, dass alles von Gott geschaffen ist. Damit wurde Thomas – quasi nebenbei – auch zu einem der wichtigsten Gründungsväter moderner Wissenschaft und ihrer Methoden. Einen Verstand von der Schärfe und Unbestechlichkeit eines Thomas von Aquin bekommt die Menschheit nur äußerst selten geschenkt; er ist eine Ausnahmeerscheinung, gewissermaßen ein Jahrtausend-Genie.
Ausnahmetalent …
Für seine Zeitgenossen war das aber zunächst nicht ausgemacht, schon gar nicht für seine Verwandten. Ob er das demutsvoll als eine Parallele zu seinem Herrn erlebt hat? Seine Lebensgeschichte ist recht farbig und zeigt ihn in der Überwindung unzähliger Hindernisse. Mit aller Gewalt hatte seine Familie versucht, ihn auf einen konventionellen Lebensweg zu zwingen. Doch Thomas fand seinen eigenen Weg, besser gesagt seine Berufung, und die führte ihn zunächst in einen der damals noch aufregend neuen und hoch „umstrittenen“ Bettelorden (er trat in den noch jungen Dominikanerorden ein). Aber auch dort hatte er es zunächst nicht leicht, und seine Mitstudenten machten sich zuweilen über sein stilles Wesen und seine Körperfülle lustig. Kann man es fassen, dass ein Genie von seiner Größe mit dem Spitznamen „stummer Ochse“ gehänselt wurde?
… in bewegten Zeiten
Die familiären Hintergründe des Aquinaten sind verzweigt und durchaus europäisch. Und auch sein Leben war geprägt von Reisen und Beziehungen in ganz Europa. Im dreizehnten Jahrhundert gab es einen regen Wissenschaftsaustausch zwischen den europäischen Metropolen des Wissens – Bologna, Neapel, Paris, Köln… Und es war in Köln, dass Thomas’ außergewöhnliche Begabung und Berufung zuerst richtig erkannt wurde. Sein Lehrer Albertus Magnus war es, der weitsichtig und weise (aber auch demütig) genug war, um zu erkennen, dass hier ein Kirchenlehrer von einzigartiger Größe vor ihm stand.
Der „allgemeine Lehrer“
Thomas’ monumentale und zugleich äußerst feinsinnige theologische Leistung hat ihm schon bald den Ehrennamen „Doktor angelicus“ eingebracht: der „engelsgleiche Lehrer“[3]. Sein Opus magnum, die „Summa theologica“[4], ist bis zum heutigen Tag ein Schatz der Weisheit und des Glaubens. Geschrieben hatte er es als eine Art Einstiegshilfe für junge Theologen, quasi als Schulbuch! Dabei zeigte sich auch sein Talent der klaren und verständlichen Formulierung schwer zu fassender Tatbestände. Auch die größten theologischen Begabungen des 20. und 21. Jahrhunderts können noch daraus schöpfen und davon lernen. Immer wieder verblüfft Thomas mit scharfsinnigen Erkenntnissen und Überlegungen, mit denen er seiner Zeit weit voraus war.
Nun mag man fragen: Nach so viel panegyrischem Überschwang – was hat er denn nun gebracht, was es vorher nicht gab? Was man nicht wusste oder verstand? Und wieso ist das noch heute relevant? Die kurze Antwort darauf lautet: Er hat, wie keiner vor ihm und wenige nach ihm[5] gezeigt, dass Vernunft und Glaube zusammengehören wie zwei Seiten einer Medaille – zu unterscheiden, aber nicht zu trennen voneinander.
Universalgelehrter und einfacher Glaubender
Thomas hat auf allen wesentlichen Gebieten der Philosophie und Theologie und fast des ganzen Wissens seiner Zeit Großes geleistet, von der damals aufregend neuen und vertieften Aristoteles-Rezeption, bis zur Erklärung und Vermittlung der Eucharistie, die ja „die Mitte der Kirche“ ist[6]. Aber er blieb stets der leutselige und bescheidene Mann, der er immer war, im Herzen ein „einfacher Glaubender“. Eine schöne Erzählung aus jener Zeit besagt, dass Thomas einmal die Stimme des Herrn vom Hochalter vernommen habe, der seine Arbeit mit den Worten lobte „Bene scripsisti de me, Thoma!“ (Gut hast Du über mich geschrieben, Thomas!). Auf die Frage des Herrn, was er als Belohnung wünsche, soll Thomas geantwortet haben: „Non aliam nisi te, Domine“ (nichts außer Dir, o Herr).
Hinter dieser kleinen, anrührenden Geschichte scheint nicht nur die große Gelehrsamkeit des Thomas auf, sondern auch seine Demut, für die er seinen Zeitgenossen bekannt war. Aber noch etwas anderes wird hier erkennbar. Der große Denker, Mann des Verstandes und der messerscharfen Argumentation, hatte auch eine mystische Seite (wie sehr viele Heilige), selbst wenn er darüber kaum schrieb und sprach. So beendete er nie sein Opus magnum, die Summa theologica; sie blieb Fragment, freilich auch so ein epochales Werk von bleibendem Wert. Auf das Drängen seiner Freunde, doch mit der Arbeit fortzufahren, antwortete er ablehnend: „Alles, was ich geschrieben habe, kommt mir vor wie Stroh, verglichen mit dem was ich geschaut habe“[7]. Ganz offensichtlich war dem großen Heiligen die Gnade einer besonderen, die äußere Welt transzendierenden Sicht, einer tiefen Vision, zuteil geworden.
Heiliger und Kirchenlehrer – aktueller denn je
Thomas von Aquin wurde schon knapp fünfzig Jahre nach seinem Tod heiliggesprochen. Er blieb der paradigmatische Kirchenlehrer, und mit seinem Namen ist der „Thomismus“ als Basis kirchlicher Lehre dauerhaft verbunden. Papst Leo XIII.[8] erhob ihn mit der Enzyklika „Aeterni patris“ (1879) zur schlechthin maßgeblichen Autorität für Lehre und Auslegung. Hintergrund waren vielfältige Anfechtungen und krisenhafte Entwicklungen in Kirche und Theologie jener Zeit. Da wurde ein festes Fundament aus Wissen und Glauben dringend benötigt.
Bestimmte Fortentwicklungen des Thomismus wurden später kritisiert, weil sie allzu schematisch und kompliziert geworden seien. Das tut aber dem eigentlichen Werk des Thomas keinen Abbruch. Es ist vielmehr bei genauerer Betrachtung noch immer von einer beeindruckenden Frische und Aktualität. Gerade in unserer Zeit – die für Kirche und Glauben mindestens ähnlich krisenhaft ist, wie das dreizehnte oder das neunzehnte Jahrhundert – kann eine Rückbesinnung auf den „Doctor angelicus“ nur von Nutzen sein.
(Postumes Gemälde von Carlo Crivelli, 1476)
[1]1225 bis 1274. Zu Leben und Werk besonders empfehlenswert: Josef Pieper: Thomas von Aquin. Leben und Werk. 1958. Neuausgabe hrsgg. v. Berthold Wald 2014. Von Bf. Robert Barron, einem großen Verehrer des Aquinaten, gibt es viele lesenswerte Beiträge zu seinem Werk. Vgl. auch: https://www.youtube.com/results?search_query=Robert+Barron+on+Thomas+Aquinas
[2]Ein Gedanke, den auch Albert Einstein aufgriff, der es als äußerst staunenswert und geradezu wunderbar empfand, dass die Welt überhaupt in einer Weise strukturiert ist, die sie unserem Denken zugänglich macht.
[3]Oder auch „Doctor communis“ – der Lehrer schlechthin.
[4]Auch „Summa theologiae“.
[5]Ein Beispiel aus unserer Zeit ist zweifellos Joseph Ratzinger / Benedikt XVI., dessen Lebensthema ebenfalls die Verbindung von Glaube und Vernunft war.
[6]Vgl. die Enzyklika von Papst Johannes Paul II.: Ecclesia de Eucharistia.
[7]Pieper a.a.O. S. 23.
[8]Vgl. hierzu: Jörg Ernesti: Leo XIII. Papst und Staatsmann. Freiburg 2019. Insbesondere Kap. 10.