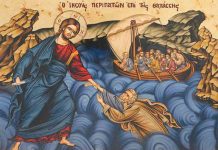Wenn wir von außergewöhnlichen Heiligen hören, die weit jenseits jeder „Komfortzone“, unter Gefahren bis hin zur Aufgabe ihres Lebens gewirkt haben, dann denken wir oft, teils anerkennend, teils leicht schockiert: „Die sind aber hart im Nehmen…!“ Irgendwie scheint uns dabei klar zu sein, dass „sowas“ nicht unser Ding sein kann, und oft stimmt das sogar: Unter primitiven Bedingungen Leprakranke zu pflegen, sich um Kriegsopfer und Verfolgte zu kümmern, in Armenvierteln täglich das Elend auszuhalten – das ist nichts für jedermann. Um so erstaunlicher, dass so zerbrechlich wirkende, unauffällige Menschen wie Mutter Teresa das schafften.
Wer einmal einen Eindruck davon erhalten möchte, was ein echter Slum ist, der sollte das Buch „Stadt der Freude“[1]von Dominique Lapierre lesen. Es beschreibt besser als viele reißerische Filme und Reportagen oder sentimentale Spendenaufrufe die Realität eines der schlimmsten Elendsviertel der Welt, ohne dabei hoffnungslos oder nihilistisch zu werden. Relevant und auf beunruhigende Weise zeitlos ist es aber auch als historisches Zeugnis über genau jenes Umfeld, in dem Mutter Teresa jahrzehntelang mit wahrhaft heiligmäßiger[2] Hingabe und Geduld gewirkt hat.
Noch im Osmanischen Reich im Jahre 1910 geboren, hatte die aus einer albanischen Familie stammende Anjezë Gonxhe Bojaxhiu als junges Mädchen ihre Berufung zur Ordensfrau erfahren, und sie wirkte dann den größten Teil ihres Lebens in Armenvierteln in Indien, wo sie 1950 die Gemeinschaft der „Missionarinnen der Nächstenliebe“ gründete. Sie verstarb 1997 in Kalkutta, am Ort ihres Wirkens – übrigens nur wenige Tage nach dem Unfalltod der Lady Diana in Paris, wodurch ihr Ableben in den Windschatten des Medien-Hypes um das tragische Ende der Princess of Wales geriet und vergleichsweise weniger Aufmerksamkeit fand. Das muss ganz in ihrem Sinne gewesen sein, und es passt zu ihrem Leben für Andere, in dem sie sich und ihre Person niemals in den Vordergrund gestellt hat.
Mutter Teresas Leben für die praktische Nächstenliebe ist geradezu sprichwörtlich geworden. Und doch hat sie uns sogar darüber hinaus noch vieles zu sagen – über Beständigkeit im Glauben, über Furchtlosigkeit des Bekenntnisses und darüber, wie sich aktives und kontemplatives Leben ergänzen und gegenseitig stützen.
Ihren Ordensnamen Teresa hatte sie nach dem Vorbild der heiligen Thérèse de Lisieux gewählt. Das mag überraschen, denn das kurze Leben der „kleinen Therese“ war ja ganz dem Gebet in der Abgeschiedenheit des Klosters und der Kontemplation gewidmet, während Mutter Teresa so mitten im profanen Leben, auch in seinen Abgründen, gewirkt hatte, wie kaum eine andere. Aber auch Mutter Teresa zog ihre ganze Kraft aus dem Gebet und der Eucharistie. Das war das „Geheimnis ihres Erfolges“, nur so hatte sie nicht nur allen Herausforderungen standgehalten, sondern auch immerzu Frohsinn und Freundlichkeit ausstrahlen können.
Und ähnlich wie Thérèse de Lisieux hat auch Mutter Teresa spirituell schwere Zeiten erlebt, Zeiten, in denen sie bedrängt wurde von der scheinbaren Abwesenheit Gottes, von Anfechtungen und Zweifeln. Aber beide Frauen, so unterschiedlich ihr Wesen und ihr Weg auch waren, haben diese Krisen überwunden, indem sie unerschütterlich an ihrem Glaubensleben festhielten. So standen sie nicht nur beispielhaft für die Tugenden der Frömmigkeit und der Nächstenliebe, sie sind vielmehr auch leuchtende Beispiele dessen, was mit den Tugenden der Tapferkeit und Gottesfurcht gemeint ist.
Von Mutter Teresa ist eine Menge treffender, humorvoller und tiefsinniger Aussprüche überliefert. Zu den bekanntesten gehört ihre Antwort auf die Frage, was sich ihrer Meinung nach in der Kirche am dringendsten ändern müsse: „Du und ich!“ In einer Zeit des oft besserwisserischen Auftrumpfens und selbstgerechten Urteilens über die Kirche und in der Kirche ist ein solches Statement von unschätzbarem Wert. Wiederum kommen zwei Tugenden in den Sinn, die von Mutter Teresa ohne viel Aufhebens gelebt wurden: Demut und Klugheit.
Unvergessen ist auch Mutter Teresas unerschrockenes Eintreten für das Lebensrecht nicht nur der Armen und Benachteiligten, sondern auch der Ungeborenen. Dass sie sich damit nicht nur Freunde machte, bedarf wohl keiner besonderen Erwähnung. Ihre mutige Verurteilung der massenhaften Tötung Ungeborener war sicher auch der Auslöser für die schäbigen (und untauglichen) Versuche, ihr Lebenswerk nachträglich schlechtzureden. Und da man nichts finden konnte, mit dem sich ihre und ihrer Gemeinschaft karitative Arbeit beschädigen ließ, verlegten sich ihrer Kritiker darauf, ihr missionarisches Wirken zu kritisieren, so als hätte sie nicht explizit aus ihrem Glauben handeln und dadurch auch ein Glaubenszeugnis ablegen dürfen. Jeder weiß, dass Mutter Teresa ohne Ansehen der Person oder von deren Religion und sozialem Status gewirkt hat. Ebenso darf aber jeder wissen, dass sie alles aus ihrem Glauben tat. Ihr ganzes Leben ist ein leuchtendes Glaubenszeugnis. Und das ist der Grund, warum ihre Gemeinschaft sich „Missionarinnen der Nächstenliebe“ nennt.
[1]Dominique Lapierre: La Cité de la Joie. 1985 (liegt auch in deutscher Übersetzung vor).
[2]Sie wurde 2003 von Papst Johannes Paul II. seliggesprochen. Die Heiligsprechung erfolgte durch Papst Franziskus 2016, quasi als Höhepunkt des außerordentlichen Heiligen Jahres der Barnherzigkeit.